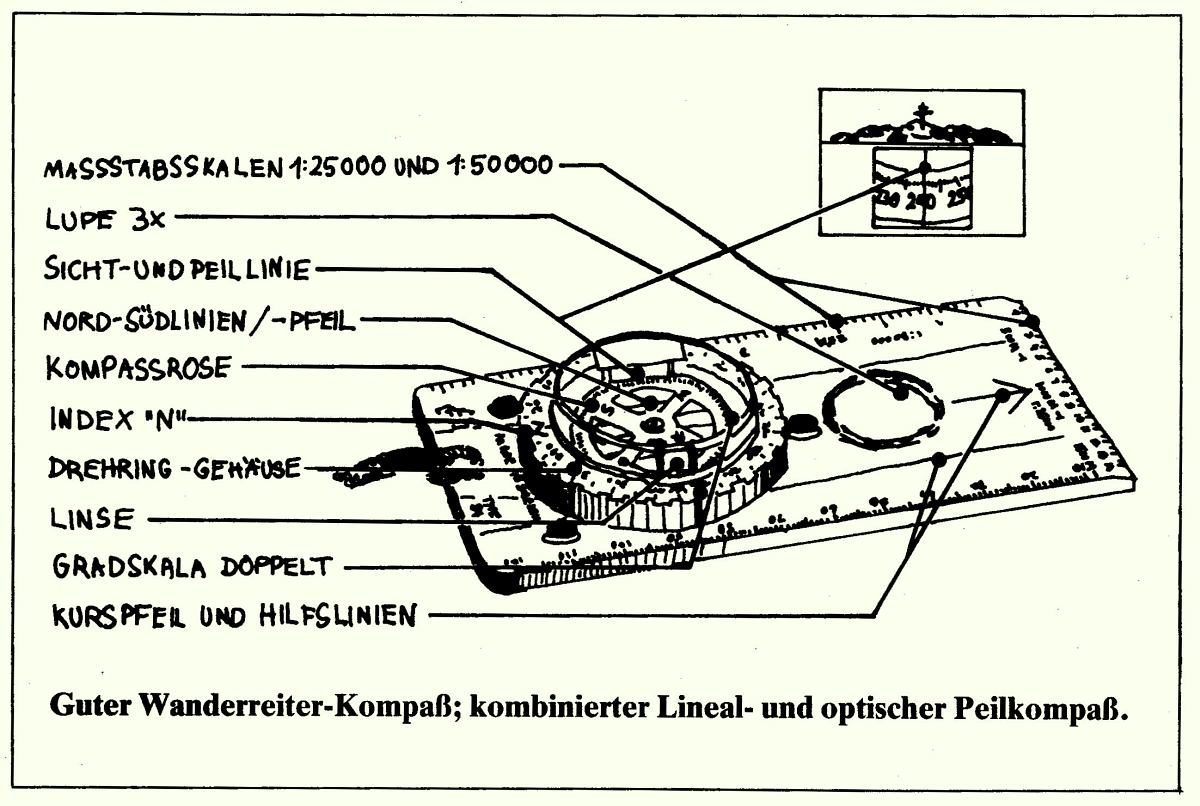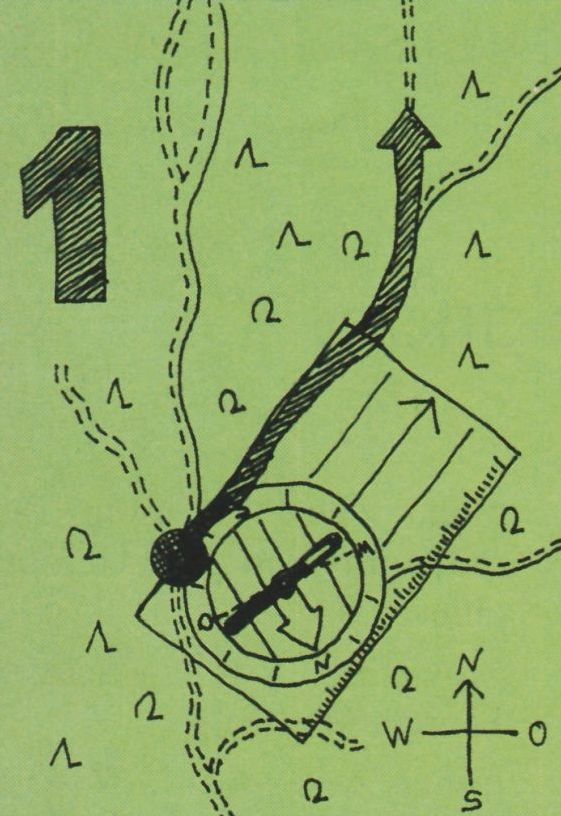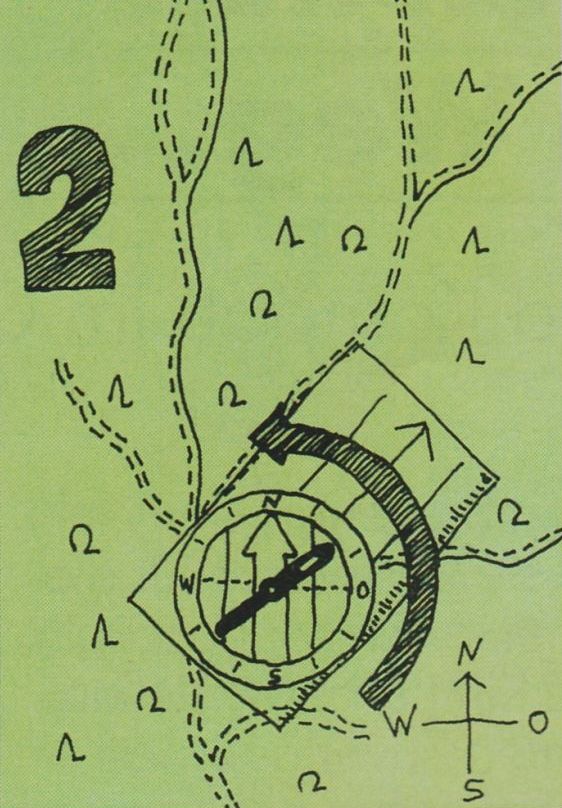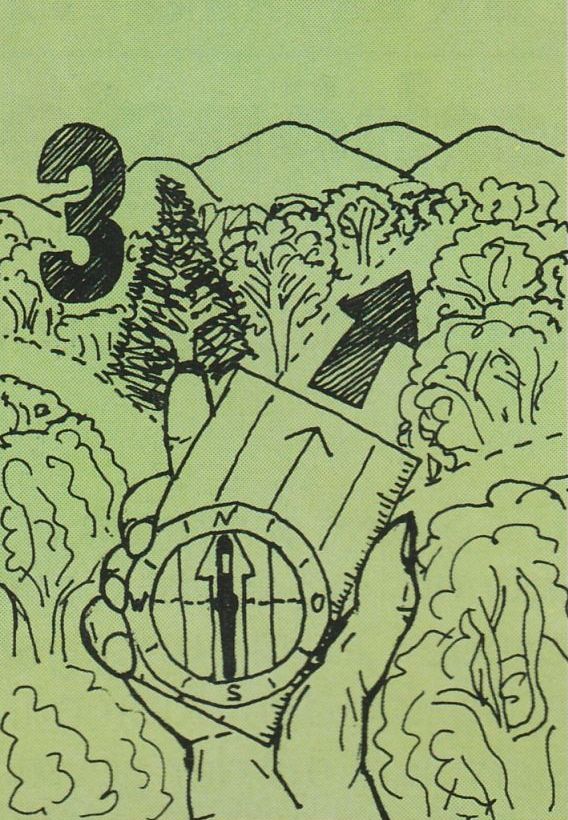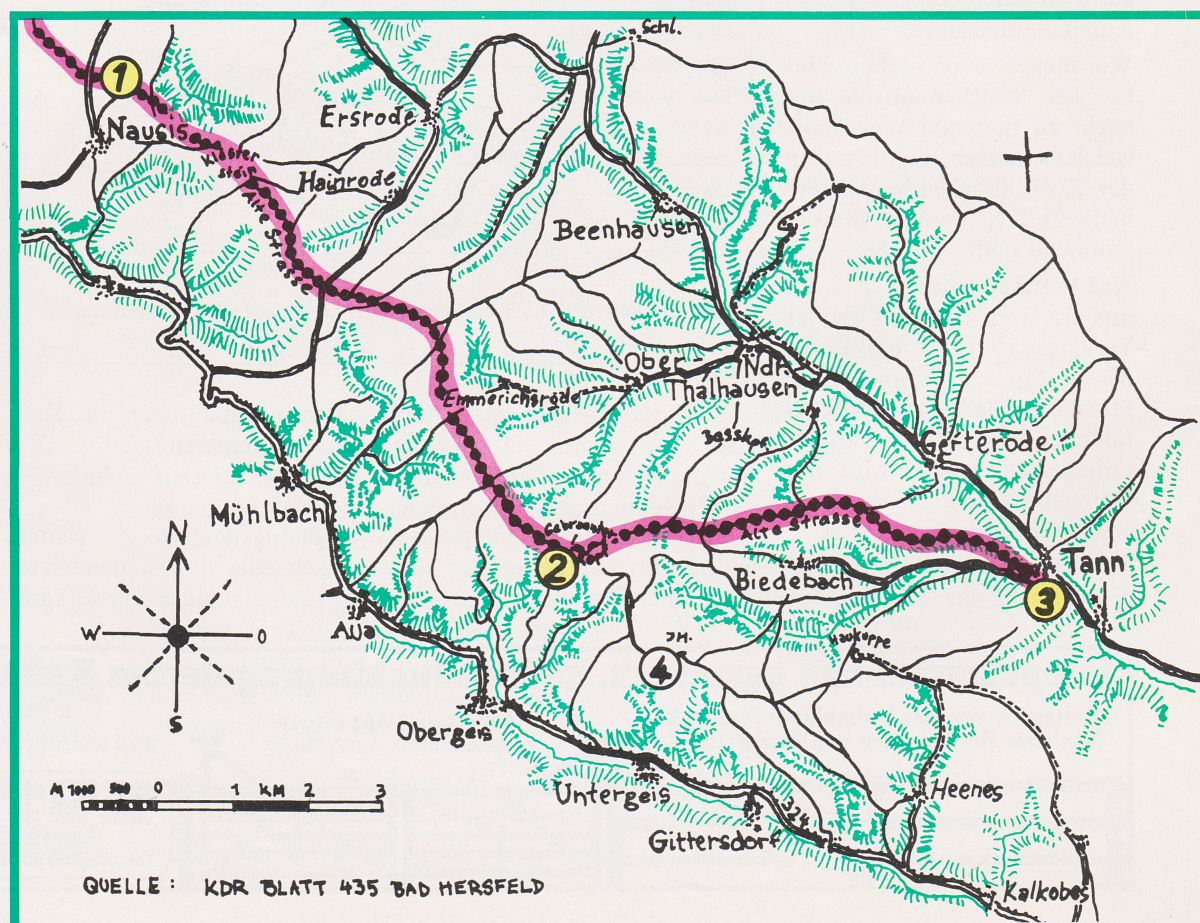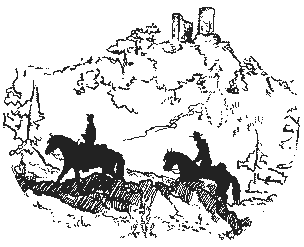
|
TAUNUSREITER
(c) Frank Mechelhoff 2006 - Kopien
speichern nur zum privaten Gebrauch zulässig
Verwendung von Texten und Bildern in eigenen
Websites oder zu geschäftlichen Zwecken ohne meine
schriftliche Genehmigung nicht gestattet
Kontakt: taunusreiter  yahoo.de
yahoo.de
Ursprung des Artikels 1991, überarbeitet Dez. 2019 |
Wir nehmen den schönsten
Weg...
Orientierung mit Karte und Kompass
Mit Karte und Kompass im Gelände
Die Sonne scheint in unseren Breitengraden nicht immer -
und selbst wenn, ist sie bestenfalls für die grobe Orientierung
geeignet. Auch Mondschein, Moos an den Bäumen, alte Kirchen usw.
stellen sich nicht mit der gewollten Zuverlässigkeit ein. Neben
der guten Karte ist daher der Kompass das Hilfsmittel zur
Orientierung im unbekannten Gelände
Moooment! Sie möchten zuerst mal wissen, wie man sich
mit der Karte allein orientiert, bevor Sie was über Karte
und Kompass erfahren??
Das ist absolut sinnvoll. Klicken Sie bitte
hier!
Der Gebrauch des Kompass
Der Wanderreiter1) will
möglichst wenig mit technischen Dingen zu tun haben, er - oder sie
– sucht das Naturerlebnis, die Kameradschaft unter
Gleichgesinnten, die Herausforderung, das Reiterlebnis usw.
Im unbekannten Gelände wird er versuchen, den für ihn
besten Weg auf der Karte festzustellen. Der beste Weg für den
Wanderreiter ist nicht der schnellste, noch der kürzeste, sondern
der landschaftlich schönste Weg, der noch flüssig zu reiten ist.
Das sichere Auffinden dieses Weges wird durch den Einsatz des
Kompass erleichtert.
Wer ohne Kompass reitet, wird bei der Streckenwahl auf leicht zu
findende Wege ausweichen müssen, die näher an der Zivilisation
verlaufen und meist fester, weniger pferdeschonend sind.
Auf Wettbewerben – etwas auf unmarkierten Distanz- oder
Trekkingritten – kommt es insbesondere darauf an, eine vorgegebene
Strecke schnell und sicher zu finden. Wer hier, wenn die
Orientierung kritisch wird, mit Kompass arbeiten kann, ist
eigentlich immer im Vorteil.
Nun hat auch der Kompass-Fan nicht ständig das Gerät vor der Nase,
braucht es vielleicht manchen Reittag gar nicht. Hierzulande ist
die Landschaft meist offen, mit sichtbaren, eindeutigen
Geländemarken, die man in der Karte wiederfinden kann. Der Kompass
erleichtert vor allem das Durchreiten von schwierigem Gelände, wo
solche Marken selten sind oder ganz fehlen, wie in großen
Waldgebieten, dünnbesiedelten Gegenden usw. – eben den
Landschaften, die den passionierten Streckenreiter wie ein Magnet
anziehen... Dies sind unbestreitbare Vorteile -- die den Nachteil,
sich mit einem zusätzlichen „Ding“ beschäftigen und beschweren zu
müssen, bei weitem mehr als aufwiegen. Sichere zuverlässige
Orientierung, wozu der Kompass entschieden nützlich ist, macht den
Ritt sicherer und entspannender, und mindert ganz gewiss nicht
Erlebnis und Abenteuer.
Der Wanderreiterkompass
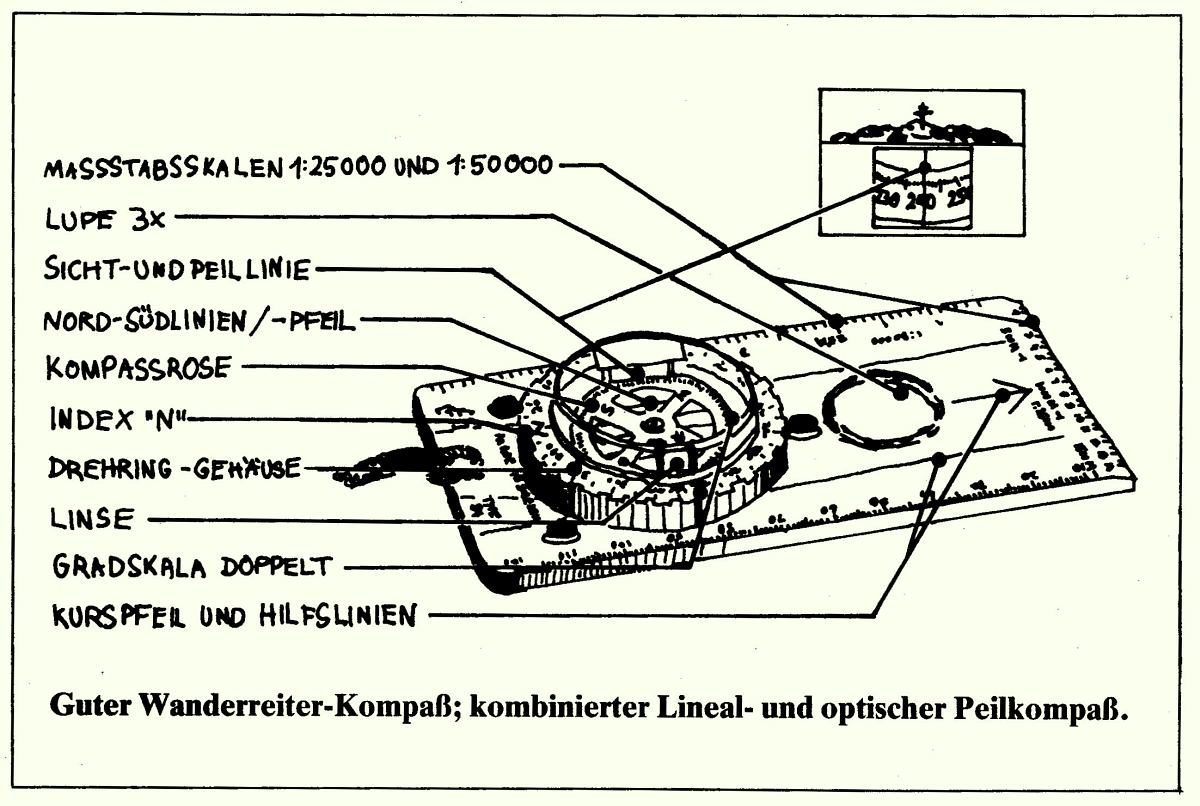
In der hiesigen Landschaft wird der Kompass immer zusammen mit
der Karte benutzt, da wir auf den Wegen zu reiten haben. Wir
brauchen daher einen Kompass, der die Kartenarbeit
unterstützt. Die wichtigsten Anforderungen an einen solchen
Kompass sind:
- Fluidgedämpfte Nadel, schnelle Einpendelzeit (einen guten
Kompass kann man, falls erforderlich, selbst im Trab oder Galopp
ablesen!)
- Möglichst großer, weichgängiger und deshalb präzis
einstellbarer Kompaßdrehring
- Lange Anlegekante für die Kartenarbeit (wenn die
Kompaß-Grundplatte aus Acrylglas ist, ist dies zusätzlich von
Vorteil), Lupe und aufgedruckts Lineal und Maßstabsskalen für
die üblichen Karten sind nützlich und hilfreich
- Peilvorrichtung oder Spiegel sind nett, aber nicht unbedingt
notwendig, da der Wanderreiter den Kompass fast immer aus der
Hüfte benutzt
- Wichtiger ist es, dass das Verletzungsrisiko gering ist,
besonders wenn der Kompaß um den Hals getragen wird. Viele große
Kompasse sind scharfkantig, oder taugen eher um damit am
Stammtisch anzugeben.
Gut brauchbare, einfache Modelle vom Typ Linealkompaß, wie sie
auch von Geländeläufern verwendet werden (für Einsteiger besonders
zu empfehlen und mit bereits ausreichender Genauigkeit) gibt es
bereits ab 15,- Euro.

Silva Type 4/54, empfehlenswerter großer Linealkompass mit Lupe und
gut sichtbarem Richtungspfeil. Die lange Anlegekante erleichtet die
Kartenarbeit und erlaubt überschlägige Entfernungsmessungen.
Die wichtigsten Handgriffe
A) Bestimmung der Marschrichtung aus der Karte
Die folgende Situation kennt jeder: Man will in eine
bestimmte Richtung reiten, ist sich aber unsicher über den
richtigen Weg (etwa an einer Kreuzung mit vielen Abzweigungen).
Was ist zu tun?
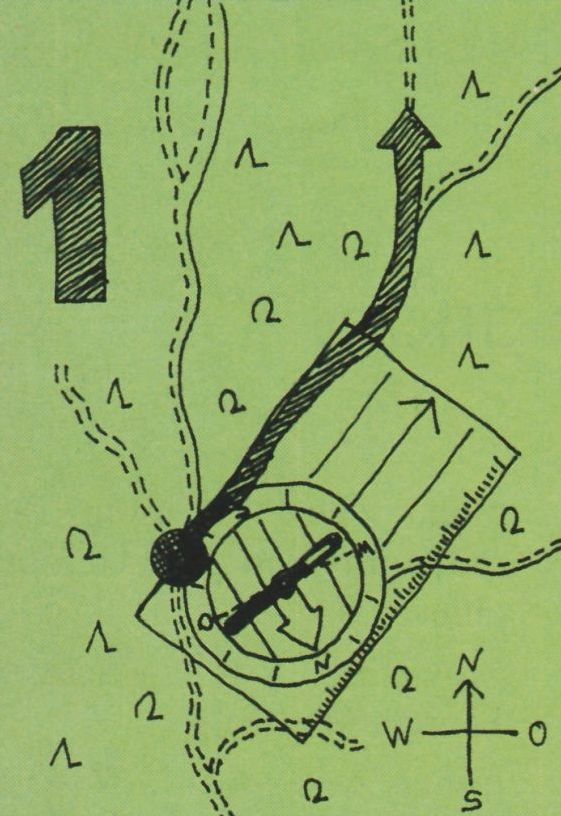
(1) Den Kompaß mit der Anlegekante bzw. dem Richtungspfeil
parallel zum gewünschten Kurs auf die Karte halten.
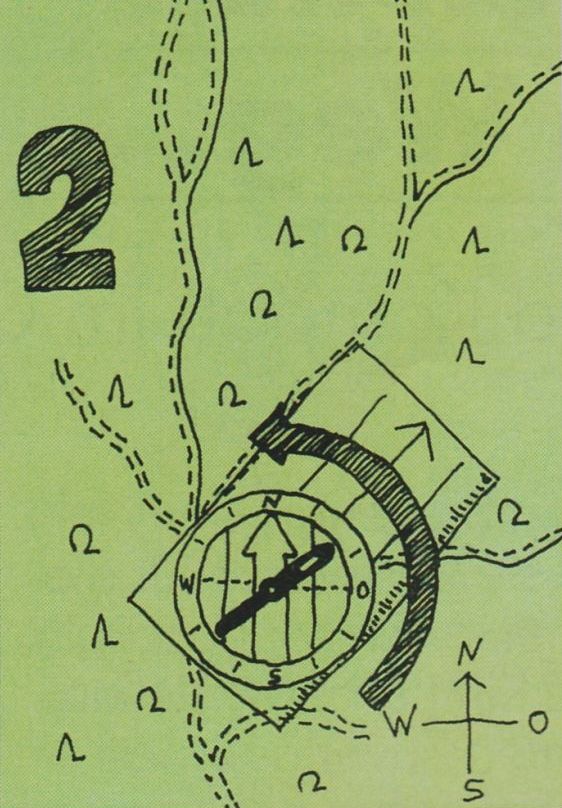
(2) Den Kompass-Drehring auf Karten-Nord verstellen, ohne
den Kompass in seiner Lage zu verändern. Die Nord-Süd-Linien im
Kompassboden erleichtern die Ausrichtung. Auf der Karte ist es das
aufgedruckte Koordinatengitter.
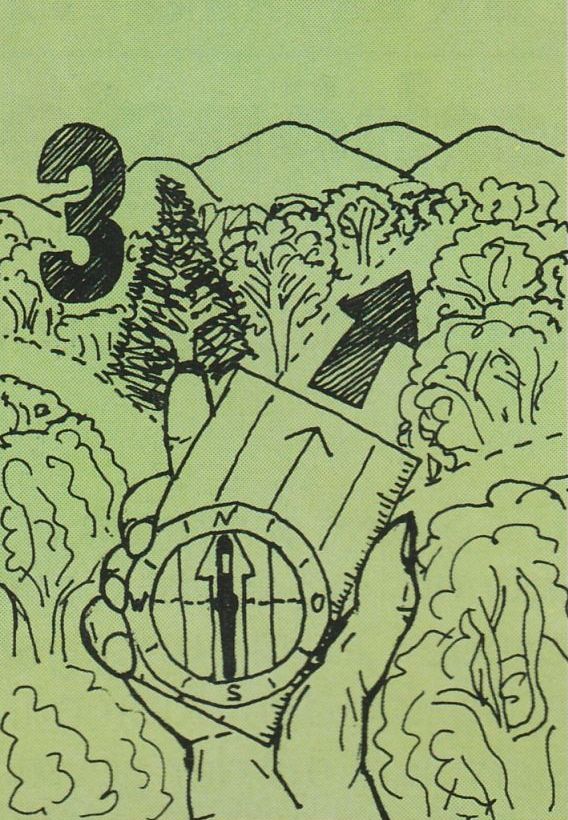
(3) Den Kompass von der Karte nehmen und in Bauchhöhe am
ausgestreckten Arm langsam drehen, bis die Kompassnadel
sich am Nordindex „N“ des Drehrings eingespielt hat. Der große
Richtungspfeil weist nun vom Reiter weg in die gewünschte
Richtung.
Das klingt beim Lesen etwas kompliziert, ist aber in Sekunden
gemacht -- und auf jeden Fall schneller, als an der Kreuzung zu
stehen und herumzurätseln! Wie die Karte dabei gehalten wird, ist
dabei ganz egal – man muß nur wissen wo Norden ist (bei
topographischen Karten ist das immer oben).
B) Überprüfung der Marschrichtung
Die gleiche Vorgehensweise wie oben - bei Unsicherheit, ob man
noch auf dem richtigen Weg ist. Man mist den „Sollkurs“ auf der
Karte aus (wie A, 1. und 2. Schritt) und hält dann den Kompass in
die gerittene Richtung, also gerade nach vorwärts. Pendelt sich
die Kompassnadel am eingestellten Nordpfeil (Index „N“) ein, ist
alles okay. Wenn nicht, stimmt der Weg nicht.
Nun kann man noch...
C) einen Weg auf der Karte indentifizieren
Der „umgekehrte Weg“ von A, Schrit 3 zu Schritt 2. Der
Kompass wird, mit dem Kurspfeil vom Reiter weg, in die gewünschte
Richtung gehalten und der Drehring dabei gedreht, bis die
Kompassnadel und der Index „N“ am Nordpfeil übereinstimmen. Jetzt
wird der Kompass auf die Karte gelegt (wobei der Nordpfeil und „N“
wieder auf Karten-Nord weisen müsen). Der ausgemessene Weg liegt
nun irgendwo auf der Karte, parallel zur
Kompass-Anlegekante.
In Gebieten in denen nicht alle Wege „schachbrettartig“ angelegt
sind, kann eine solche Messung schon viel Klarheit über die eigene
Position auf der Karte bringen! Nimmt man noch zusätzliche
Geländemarken wie Steigung, Kurven des Weges o.ä. in die
Überlegung auf oder mißt an einer Kreuzung einen zweiten Weg aus,
so kann man in den meisten Fällen den eigenen Standort mit großer
Sicherheit bestimmen – besonders in hügeligem Gelände sind zwei
Kreuzungen kaum je gleich!
D) Anpeilen unbekannter Punkte im Gelände
Dies ist selten notwendig, kann aber ganz nett sein,
wenn man etwa wissen möchte, was für einen Berg man da irgendwo in
der Ferne sieht.
Man peilt dieses Objekt wie im Abschnitt C beschrieben an und mißt
widerum mit dem Drehring die Richtung. Hier ist nun höhere
Genauigkeit (1-2°) gefragt und daher eine Peilvorrichtung wie
Spiegel oder Prismatik am Kompaß nützlich. Aus der Hüfte kann man
5-10° Genauigkeit erzielen was für die o.g. Zwecke üblicherweise
ausreicht.
Das gesuchte Objekt liegt nun in der Verlängerung des eigenen
Standortes mit der Kompaß-Anlegekante, und Ausrichtung Index-„N“
mit Karten-Nord. Wenn man Pech hat, ist das angepeilte Objekt so
weit entfernt, dass es nicht mehr auf der Karte ist...
Über das Kreuzpeilen will ich hier nichts weiter sagen, es ist
eine in der Literatur häufig beschriebene Methode der
Standortbestimmung anhand zweier oder mehr bekannter Landmarken,
hauptsächlich für Küsten- und Seenavigation verwendet. Wenn man
sich in hiesigem Gelände verreitet, hat man diese zwei Punkte
meistens nicht und kommt mit der unter C) beschriebenen Methode
besser weiter.
Auch das Einnorden der Karte wird häufig beschrieben: Ein
zu Pferde etwas umständliches Verfahren, um sich auf der Karte
zurechtzufinden (sie sich quasi so zu drehen wie die Landschaft
vor einem liegt) - und in den meisten Fällen nicht genau genug.
Aber für den Anfänger in der Kartenarbeit nahezu unumgänglich. Für
die Fortgeschrittenen ist es zumindest dann unnötig, wenn man die
Karte "geistig" eingenordet hat, also die Vorstellung hat was
„rechts-“ oder „linksabbiegen“ auf der Karte bedeutet - was leicht
zu verwechseln ist wenn man nach Süden, d.h. ie Karte „herunter"
reitet!
Kompaßgebrauch an einem Beispiel
An einem praktischen Wanderreiter-Beispiel werden
Vorgehensweise und Notwendigkeit sofort klar.
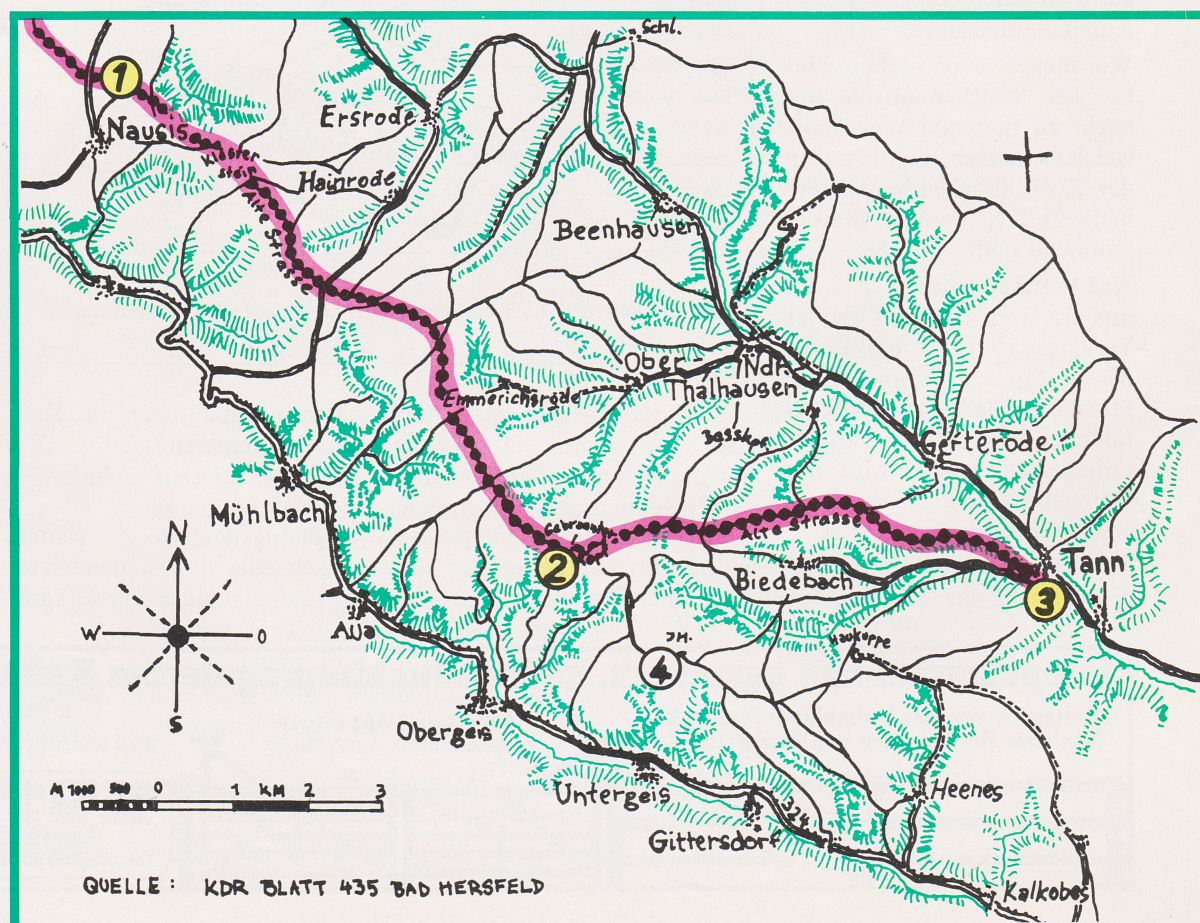
Ich will die „Alte Straße“ zwischen Nausis und Tann, einem
nordhessischen Höhenweg, bereiten (Punkte 1-2-3 auf der Karte). Die
Strecke führt ca. 15 Kilometer durch Wald; deutliche Geländemarken
wie Straßenübergänge, Berge, markante Kreuzungen o.ä. gibt es kaum.
Die Schwierigkeit besteht darin, nicht vom Haupt-Höhenweg
abzukommen (etwa in Richtung Beenhausen) – und dann gibt es noch das
Herausforderung, nach 9 Kilometern am Gebrannten Kopf (Punkt
2) die richtige Abzweigung zu finden. Markierungen und Wegweiser
waren, als ich hier 1988 erstmals ritt, nur noch sporadisch
vorhanden - zuletzt (2015) fehlten sie vollständig.
Wie ist vorzugehen? - Westlich von Emmerichsrode führt der Weg ein
ganzes Stück nach Süden, dann südöstlicher. Ich stelle den Kompaß
auf dem erwarteten Kurs ein und behalte im Auge, ob der gerittene
Weg diesem Kurs auch folgt.
Wenn ich ahne, mich dem Punkt 2 zu nähern (Gebrannter Kopf), stelle
ich den Kompaß auf die neue erwartete Marschrichtung nach Punkt 3/
Tann ein – etwa Ost bis Nordost. Den ersten Abzweig mit diesem Kurs
reite ich.
Finde ich keine Abzweigung und komme stattdessen wieder
nach Süden ab, dann bin ich an der richtigen Stelle bereits
vorbeigeritten (auf Punkt 4 zu). Nun kann ich beispielsweise den
erstbesten Weg nach Osten nehmen, damit ich wenigstens in der Nähe
der richtigen Stelle herauskomme.
Hier zeigt sich der Nutzen des Kompass: Selbst wenn man sich einmal
verreitet kommt man bei entsprechender Aufmerksamkeit nur wenig ab,
vielleicht 200 oder 500 Meter – reitet aber nie total in die falsche
Richtung. Der Laie hat vielleicht keine Vorstellung davon, daß auch
der größte „Orientierungs-Crack“ nur nach der Methode
„Trial&Error“ und nicht etwa nach einem im Kopf eingebauten
Kompass arbeitet... Im obigen Beispiel, dem dichtbewaldeten
Nordhessen, kann der „Irrtum“ ohne Kompass leicht 10
Kilometer betragen. Da es ein Gesetz ist, dass solche Fehler immer
bei Ermüdung, spät nachmittags, unter Zeitdruck, bei Schlechtwetter,
und anderen unerfreulichen Bedingungen auftreten, sind die Folgen
solch harscher Verritte leicht vorstellbar. Angenehm sind sie nie.
Gut zu wissen daß es ein Werkzeug gibt, um sie auf das
unvermeidliche Maß zu minimieren.
Worauf noch zu achten ist
A) Deklination
Das ist die Nadelabweichung von magnetisch zu geographisch
Nord, auch Missweisung genannt. Diese ist überall in der
Welt verschieden und im Laufe der Zeit (Jahrzehnte) veränderlich. In
Deutschland liegt sie derzeit um 1° und kann daher für unsere Zwecke
vernachlässigt werden – nicht jedoch in vielen anderen Ländern. Hier
ist ein Kompass mit einstellbarer Missweisungskorrektur praktisch.
In seriösen Karten ist die durchschnittliche Missweisung für das
Kartengebiet verzeichnet.
B) Nadelabweichung durch Metall und Elektrizität
Von größeren Metallgegenständen (Geländern, Brücken o.ä.)
ist beim Messen 15 Meter Abstand zu halten, noch mehr bei
allen Arten von Starkstromleitungen, Transformatorenhäusern und
dergl. Nur (teure) Spezialkompasse sind für Verwendung aus dem
Auto geeignet. Die Einflüsse des Fahrzeugs und des
Magnetfeldes der Lichtmaschine müssen dabei aufwendig per Hand
kompensiert werden, und trotzdem wird keine so hohe Genauigkeit
erreicht wie beim unbeeinflussten Handkompaß des Wanderers oder
Reiters. Bereits eine Uhr, Kette o.ä. am Handgelenk, der Hand in der
der Kompaß liegt, ganz sicher ein Handy, kann die Kompassnadel
ablenken.
C) Behandlung
Ein guter Kompass ist sehr robust - vor allem geht niemals
eine Batterie leer - wird aber als Präzisionsgerät dennoch
sorgfältig behandelt – Fallenlassen, Beförderung zusammen mit harten
oder krümeligen Gegenständen (Leckerli in der Hosentasche) sind zu
vermeiden. Kleine Kompasse trägt man am besten um den Hals, etwas
größere in ledernen Gürtelhalftern neben dem Messer. Einen
fluidgedämpften Kompass nie im prallen Sonnenlicht liegenlassen
(Biergartentisch etc.) da sich bei Erwärmung hässliche Lustbläschen
im Gehäuse bilden, die das Einpendeln der Nadel verzögern können.
Die Kompassrose nicht ölen.
GPS als Alternative?
GPS (Global Positioning System) kann für den
Wanderreiter hilfreich sein, insbesondere solche mit vor dem Ritt
einprogrammierbaren, oder vom PC einlesbarer Wegpunkten. Unter
günstigen Umständen kann dieses Hilfsmittel das Verfolgen der
geplanten Strecke vereinfachen.
Jedoch auch bei sehr dichter Setzung der Wegpunkte (mehr als 75
sind selten möglich) kann GPS nie die Karte ersetzen, da es keine
Wegalternativen anbietet wenn die geplante Route aus irgendwelchen
Gründen nicht gängig ist, da es selber keine Karten genügender
Präzision bereitstellt oder einlesen lässt. Dadurch sind auch
keine Geländeschwierigkeiten, Steigungen usw. erkenn- und planbar.(das
stimmt aktuell nicht mehr!)
Zur Richtungsbestimmung bietet GPS verleichbare Menüfunktionen, ist
aber weniger reaktionsschnell und genau als ein guter und
vergleichsweise viel billigerer Kompass. Zudem funktioniert ein
Kompass unter allen oben genannten Einsatzbedingungen
verlässlich und tadellos – ohne Batterie, auch in tiefstem Wald oder
durch hohe Berge abgeschirmten Gelände, wo GPS Probleme mit dem
Satellitenempfang machen.
Aus all diesen Gründen ist es wenig ratsam, seine Orientierung und
evtl. das Wohl und Wehe einer ganzen Reitergruppe mit Pferden allein
von GPS oder anderen „Hitech“-Hilfsmitteln abhängig zu machen. Als
einziger unbestreitbarer Vorteil spricht für GPS, daß die
entsprechenden UTM-Koordinaten im Notfall zum Herbeirufen von
Rettungshubschrauber u.ä. bereits gängiger sind als die auf den
topographischen Karten aufgedruckten Gauß-Krüger-Gitter. Jedoch sind
durch kundige Personen Umrechnungen schnell möglich. GPS mag als Ergänzung
somit nützlich sein – erforderlich ist es nicht. Jeder
kompaßkundige Mensch wird nach kurzem Studium der
Bedienungsanleitung GPS benutzen können – wer nur das GPS kennt, und
den Umgang mit dem Kompass nicht in der Praxis gelernt hat, steht im
Falle eines Schadens oder einer Störung ziemlich gekniffen da!
Auf meinem Alpen-Ostsee-Ritt im Juli
2019 über 1092 km bin ich überwiegend mit Smartphone-GPS
geritten, hatte aber sowohl einen rudimentären Routenausdruck
als auch meinen guten alten Kompass als "Backup" dabei...
Fortsetzung der Artikelserie:
Neuerer Artikel (Dezember 2009) zum Thema GPS
Fußnoten:
1) Dieser, in der Urform schon ältere Artikel, verwendet die
männliche Form um flüssig lesbar zu sein. Gemeint sind natürlich
Wanderreiterin und Wanderreiter! Und die vielen "mans"
sind auch nicht geschlechtsbezogen gemeint.
Literatur für Reiter die es noch genauer wissen möchten:
Brand, Joachim: Wanderreiten. Rittplanung, Ausrüstung, Training,
1985 (S. 90-98)
Diacont, Kerstin: Wanderreiten, aber richtig. Richtlinien für
Wanderreiter, 1988 (S. 42-58)
Linke, W.: Orientierung mit Karte und Kompaß, 1987.
Thöne, K., Kaufmann, E.: Karte und Kompaß, 4. Aufl. 1989
(erstmals veröffentlicht in Freizeit
im Sattel 5/91; neu überarbeitet)
(c) Frank Mechelhoff
Dieser Text ist copyright-geschützt, wurde vom genannten
Autor erstellt und auf http://www.taunusreiter.de
publiziert.
Kopien, Ausdrucke und Verlinkung nur zum privaten,
nicht-kommerziellen Gebrauch zulässig.
Wer sich an meine Texte anlehnt oder sie kopiert, der möge mich
auch zitieren. Das gehört zur Wissenschaftlichkeit, zur
Höflichkeit und zum guten Ton, und gilt auch für die Kollegen von
der Deutschen Wanderreitakademie bzw. der VFD. Danke.
- zurück zur
Homepage -
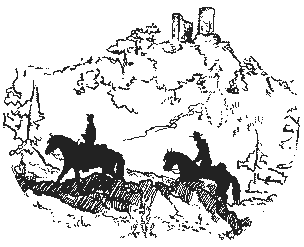
 yahoo.de
yahoo.de